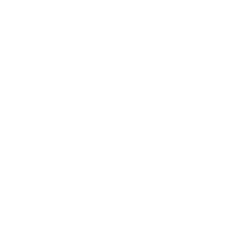Erstmal was Vernünftiges: Chemikant
Nach dem Abitur wollte ich finanziell unabhängig sein und begann im Jahr 2000 eine Ausbildung zum Chemikanten in Bitterfeld-Wolfen bei einem großen Chemie- und Pharma-Unternehmen. Eigentlich hatte ich mich um einen Ausbildungsplatz als Chemielaborant beworben, aber die waren in dem Jahr spärlich gesät. Das besondere an der Ausbildung im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen war, dass große Teile davon nicht nur im Betrieb und der Berufsschule, sondern auch in einem speziellen Bildungszentrum stattfanden.
Dort lernte ich gemeinsam mit Azubis aus anderen Firmen die Handgriffe und Grundlagen der praktischen Chemie. In einem eigens dafür ausgestatteten Lehrlabor wurden verschiedenste Substanzen synthetisiert, analysiert, filtriert, destilliert, gekühlt und erhitzt. Im Grunde genommen herrschte jeden Tag Chemieunterricht mit Experimenten!
Später kamen neben den chemischen Grundlagen auch Aspekte anderer Berufsgruppen dazu, mit denen wir später im Arbeitsalltag zusammen arbeiten würden: Mit angehenden Prozessleitelektronikern übte ich, Relais-Schaltungen richtig anzuschließen und programmierte kleine technische Anlagen. Auszubildende Industriemechaniker begleiteten mich beim Gewindeschneiden, Bohren und Feilen von Werkstücken. Später arbeiteten wir Hand in Hand an meterhohen Destillations-Kolonnen, tausende Liter fassenden Rührkesseln und mannshohen Filtrations-Anlagen.
Mit dem Fortschreiten der Ausbildung war ich natürlich auch immer öfter in den Betrieben meines Arbeitgebers vor Ort. In einer Produktionsstätte für Lacke half ich dabei, Reaktionen aus dem Labor in die Industrie zu übertragen. Ich war zur Stelle wenn es darum ging, Säcke mit Adipinsäure in einen Rührkessel zu schütten, verstopfte Rohrteile zu reinigen oder einen Kessel zu leeren, der versehentlich mit zu viel Seife gereinigt wurde und nun mit Schaum überquoll. Als Azubi lernte ich das Tagesgeschäft der chemischen Industrie aus erster Hand kennen.
Ein anderer Betrieb der selben Firma, in dem ich ebenfalls einen Teil meiner Ausbildung verbrachte, produzierte Medikamente für den Weltmarkt. Auch wenn ich kein Pharmakant werden wollte, war es doch ungemein spannend, unter Reinraum-Bedingungen in einem hoch-automatisierten pharmazeutischen Betrieb zu arbeiten. Schon damals, vor inzwischen 14 Jahren, war es dort völlig normal, dass selbstständige Roboter durch den Betrieb fuhren, die große Behälter mit verschiedensten Substanzen transportierten.
Der dritte Betrieb schließlich wurde nach dem Ende meiner Ausbildung zu meiner „Heimat“: Dort wurden Ionen-Austauscher hergestellt, die man beispielsweise einsetzt, um Wasser zu enthärten. Nachdem ich meine Prüfung nach dem dritten Lehrjahr vorzeitig ablegen durfte, gehörte ich nun zu den „Großen“. Ich sollte einen eigenen Anlagenteil „fahren“, in dem die kleinen Kunststoffkügelchen hergestellt wurden, die später das Wasser enthärten würden.
Die Arbeit war buchstäblich vielschichtig: Ich saß am Computer und bediente die Programme, die die Reaktionen in den Kesseln kontrollierten. Es gab Substanz-Proben zu entnehmen, Tanklast-Waggons mit hochkonzentrierter Schwefelsäure zu befüllen und Rührkessel mit einem gewaltigen Hochdruckreiniger zu säubern. Das Ganze im vollkontinuierlichen Vierschicht-System, das bedeutet: Drei Belegschaften arbeiten jeweils von 6 bis 14 Uhr, 14 bis 22 Uhr und 22 bis 6 Uhr. Eine vierte Belegschaft hat frei und wird nach ein bis zwei Tagen eingewechselt. Weil man laut Gesetz jeden zweiten Sonntag frei haben muss, gab es an Sonntagen nur zwei Schichten, die für jeweils zwölf Stunden arbeiteten. Insgesamt hatte ich dadurch tatsächlich jeden zweiten Sonntag frei und insgesamt ein freies Wochenende im Monat.
Die Arbeit war sehr gut bezahlt, denn für Nachtschichten und Arbeit an Sonn- und Feiertagen gab es satte Zuschläge. Auf die Dauer waren die ständigen unregelmäßigen Arbeitszeiten aber sehr erschöpfend; sowohl körperlich als auch emotional. Außerdem gab es bald für mich nichts Neues mehr zu lernen! Ich beschloss, nach einem Jahr des Geldverdienens Chemie zu studieren.
Es gibt noch so viel zu Lernen: Das Studium
Das Einschreiben in den Studiengang „Chemie – Diplom“ an der Universität Jena war problemlos, denn es gab (abgesehen vom Abiturzeugnis) keinerlei Zugangsbeschränkungen. Weil ich schon lange vorher wusste wohin ich wollte, konnte ich mich schon im Jahr davor auf die Warteliste für einen Wohnheimplatz setzen. Und so stand ich im Oktober 2004 wieder als ein Anfänger unter vielen an der Laborbank, ärgerte mich mit uneindeutigen Nachweisreaktionen herum und besuchte Vorlesungen, in denen meine Lieblingswissenschaft bis ins allerkleinste Detail erklärt wurde.
Dass ich vorher einen chemisch-technischen Beruf gelernt und ein Jahr Berufserfahrung darin hatte, war aber im Studium zu kaum etwas nütze. Im Gegenteil: Oft verwechselte man mich mit den paar gelernten Chemielaboranten meines Studienjahrgangs und verlangte deshalb manchmal Kenntnisse von mir, die ich gar nicht haben konnte.
Aber während im Laufe des Studiums etwa zwei Drittel der Studierenden scheiterten oder aufgaben, biss ich mich durch. Die Aussicht, dass mich wieder der Schichtbetrieb erwarten würde, wenn ich das Studium nicht schaffe, war eine starke Motivation. Als die Gruppen in den Kursen und Praktika kleiner wurden, lernte ich sogar einen anderen Chemikanten meines Jahrgangs kennen. Er erzählte mir, dass er nebenbei noch in seinem alten Betrieb arbeitete.
Ich erhielt das Diplom innerhalb der vorgesehenen zehn Semester und hatte während dieser Zeit erfahren, dass zu einem Chemie-Studium in der Regel auch eine anschließende Promotion gehört. Der Professor, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte, bot mir sogar eine Promotionsstelle an. Allerdings wechselte er mit seiner Forschergruppe in genau dieser Zeit an die Technische Universität Darmstadt. Für mich war das perfekt, denn meine Freundin lebte damals in der Nähe!
Zum ersten Mal richtig forschen: Die Promotion
Also zog ich zusammen mit der Forschergruppe nach Darmstadt und begann, an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Hatte ich zuvor als Student nur anderen Wissenschaftlern zugearbeitet, war ich jetzt selbst zum ersten Mal ein eigenständiger Forscher! Ich verfolgte im Labor meine eigenen Ideen, arbeitete mit Kollegen aus anderen Bereichen an gemeinsamen Projekten und reiste zu Konferenzen in verschiedene Länder. Ich betreute Studierende – sowohl im Grundpraktikum, als auch während ihrer Abschlussarbeiten. Es war eine sehr aufregende Zeit voller Ideen, Gespräche und neuem Wissen!
Mit der Zeit hatte ich auch einige gute Forschungsergebnisse veröffentlicht und es war an der Zeit, meine Doktorarbeit zu beenden. Es war gar nicht so einfach, in wenigen Wochen ein Buch über vier Jahre Forschung zu schreiben – schließlich hatte ich auch noch nie ein Buch geschrieben! Auch der dreißig-minütige Vortrag mit der anschließenden Prüfung durch vier Professoren brachte mich gewaltig ins Schwitzen. Am Ende erhielt ich aber meine Promotionsurkunde und den langersehnten Doktorgrad. Und ich wusste schon genau, was als nächstes passieren sollte: Ich würde nach Island gehen!
Auslandserfahrung: Als Post-Doc ans Ende der Welt
Während meiner Doktorarbeit hatte ich auf einer Konferenz eher zufällig einen Vortrag über ein Forschungsthema gesehen, das mich vom ersten Moment an fesselte. Während ich in dieser Zeit mit kleinen Eiweiß-Molekülen arbeitete, machte der Vortragende in seinem Labor etwas sehr ähnliches, aber mit DNA. Es war ein Professor von der Universität von Island in Reykjavik. Noch während meiner Zeit als Doktorand kontaktierte ich ihn und bewarb mich in seiner Forschergruppe als „Post-Doc“; also als ein Forscher, der bereits promoviert ist. Der Professor sagte zu und wir arbeiteten einen Forschungsplan aus. Dann, einen Monat nach dem Ende meiner Doktorarbeit zog ich zusammen mit meiner Frau in den hohen Norden. Ab jetzt forschte ich auf internationalem Niveau!
Einer meiner neuen Kollegen führte mich in die vielen Handgriffe ein, die mein Projekt erforderte. Weil es um Schwefel-Verbindungen ging, war der Gestank manchmal so stark, dass wir im Vorhinein die Feuerwehr informieren mussten, damit sie nicht von den Anwohnern alarmiert würde. Nach dem ersten halben Jahr erhielt ich sogar ein Stipendium aus Deutschland für die kommenden 24 Monate.
Die Zeit in Island war ungemein spannend und ich lernte Vieles über die Chemie, die Forschung und über mich selbst. Wenn die Zeit es zuließ, reisten meine Frau und ich auf der Insel umher. Wir sahen Wale in der Mitternachtssonne im Fjord spielen, während wir in einem „Hot Tub“ am Ufer saßen. Wir überquerten den Polarkreis am nördlichsten Punkt Islands, bestaunten die Nordlichter und besuchten Konzerte und Festivals in der nördlichsten Hauptstadt der Welt.
Erste Schritte zur Wissenschaftskommunikation
Natürlich gehörten auch weiterhin internationale Reisen zu Konferenzen und Workshops zur Forschung mit dazu. Ein Workshop in Deutschland weckte dabei eine neue Leidenschaft in mir: die Wissenschaftskommunikation. Wissenschaft ist nämlich mehr als das Erlangen von neuem Wissen. Dazu gehört auch, dieses Wissen anderen zu vermitteln. Im Normalfall redete ich als Wissenschaftler aber nur mit anderen Forschern über meine Arbeit. Meinen Freunden und meiner Familie konnte ich dagegen nur sehr schwer erklären, was ich da eigentlich im Labor trieb, und warum.
Inspiriert durch den Workshop begann ich ein Blog, in dem ich einmal pro Woche über Neuigkeiten aus der chemischen Forschung schrieb. Während meiner eigenen Forschung las ich sehr viele aktuelle wissenschaftliche Publikationen. Es sollte also ein Leichtes sein, einmal pro Woche eine von ihnen auszuwählen und eine Kurzmeldung auf Deutsch darüber zu schreiben. „Der Chemische Reporter“ war geboren!
Wenn ich in Gesprächen mit Freunden und Bekannten auf das Blog zu sprechen kam, wurden mir sofort Fragen zu bestimmten Themen gestellt, die ich bald aufgriff. Schließlich begann ich auch darüber zu schreiben, was Chemie eigentlich ist, wo sie uns überall im Alltag begegnet und welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft und die Umwelt hat. Mein Ziel war es, meiner Wissenschaft eine Stimme zu geben und den Menschen zu zeigen, dass die Chemie als Naturwissenschaft immer ein Teil der Natur ist, die uns umgibt.
Zurück in Deutschland: Neue Ziele
Nachdem ich wieder in Deutschland angekommen war, brauchte ich eine Verschnaufpause. Da meine Frau und ich nicht wussten, wohin die Arbeit uns als Nächstes verschlagen würde, zogen wir im Frühsommer in den Garten, den meine Familie uns angeboten hatte. In dieser Zeit schrieb ich die letzten Forschungsberichte und begann mich zu bewerben. Die Frage war nur, als was.
Da ich in den letzten sieben Jahren als Synthese-Chemiker geforscht hatte, bewarb ich mich in den Labors verschiedener Unternehmen. Aber meine Zweifel wurden größer, ob es das war, was ich wirklich wollte. Ich hatte ehrlich gesagt nicht Chemie studiert um hinterher einen Job in der chemischen Industrie zu bekommen; den hatte ich als Chemikant ja schon gehabt.
Meine Leidenschaft ist und bleibt die Wissenschaft, und damit das Erlangen und Vermitteln von Wissen. Durch meine Berufsausbildung, das Studium, die Promotion und die Forschung im Ausland kann ich chemische Themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und einordnen. Durch mein Blog hatte ich in den vergangenen eineinhalb Jahren ungeheuer viel Neues gelernt und wurde auch immer geübter darin, mein Wissen anschaulich zu vermitteln.
Meine Beiträge erreichten inzwischen immer mehr Menschen. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich als Wissenschaftler mit meiner Arbeit aktiv in die Gesellschaft hinein wirke. Aus diesem Grund orientierte ich mich in meinen Bewerbungen verstärkt in Richtung der Öffentlichkeitsarbeit. Und am Ende hatte ich Erfolg: Seit Beginn 2017 arbeite ich nun in der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einer unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtung.
Mein Blog werde ich nebenher natürlich weiter betreiben, wenn auch aus einer anderen Situation heraus. Die Aufklärungsarbeit über die Chemie ist mir ein so wichtiges Anliegen, dass ich damit nicht einfach aufhören werde. Und weil Chemie Alles und überall ist, gehen mir die Themen und Ideen auch nicht aus. Ich bin ich neugierig darauf, wohin dieser neue Weg mich führen wird. Genau deshalb bin ich Wissenschaftler geworden.